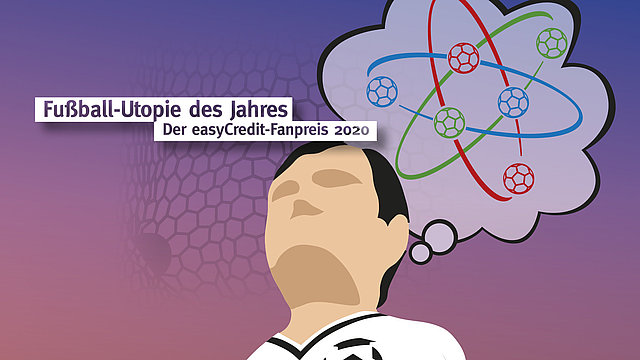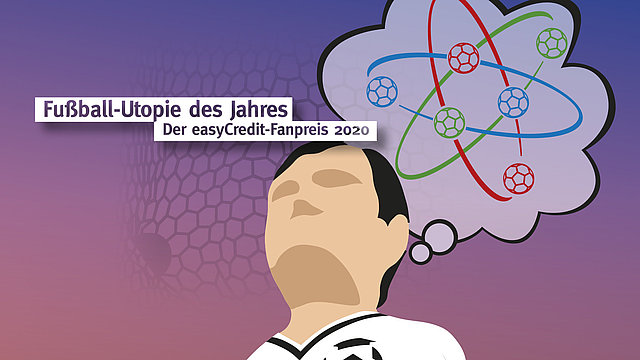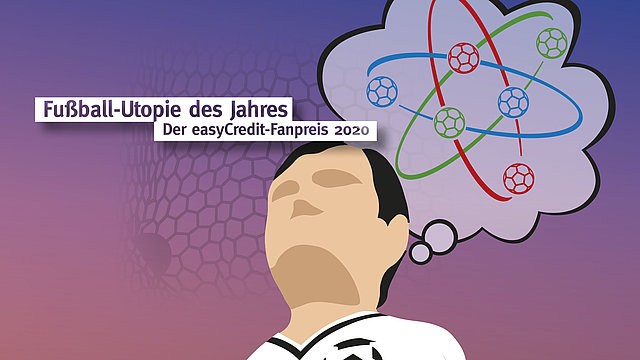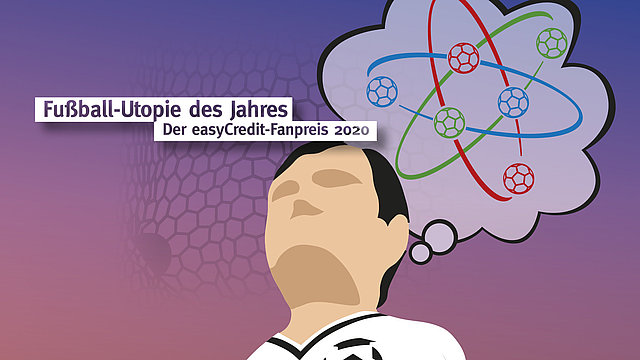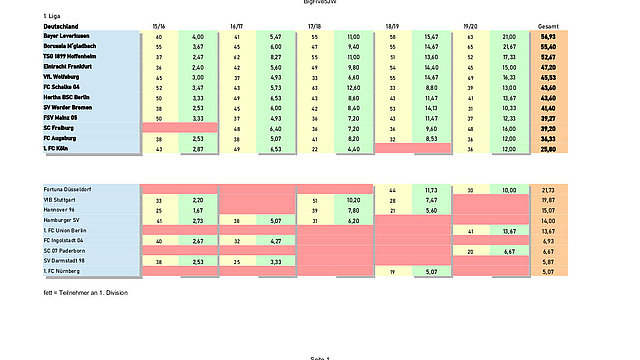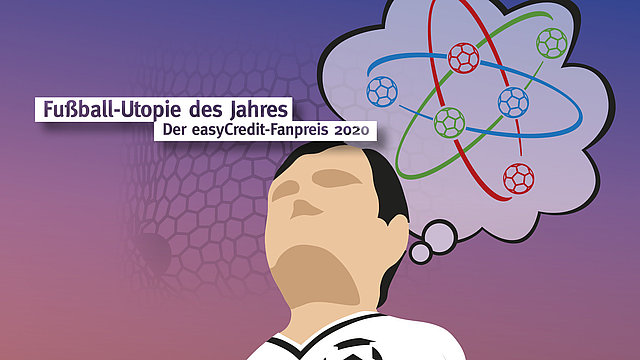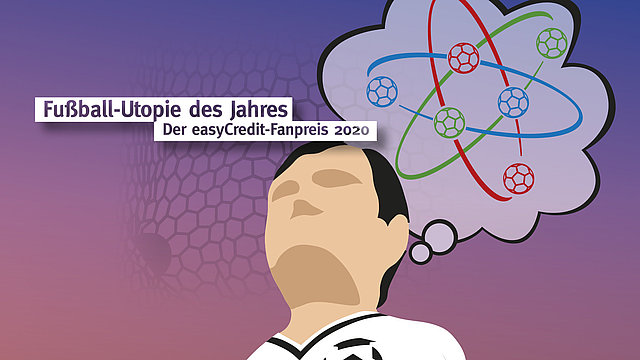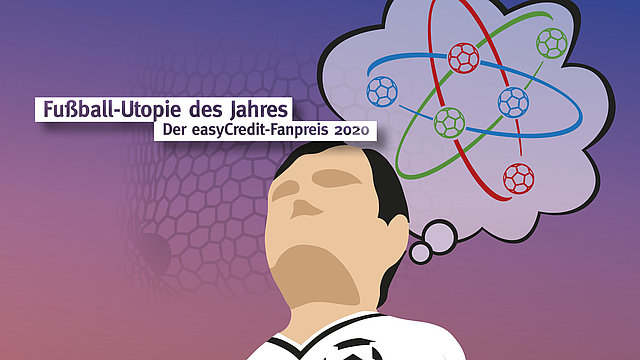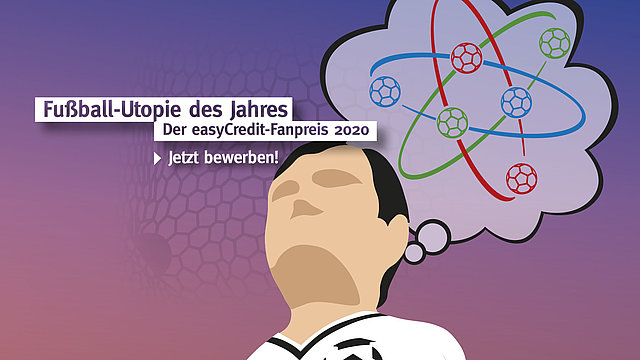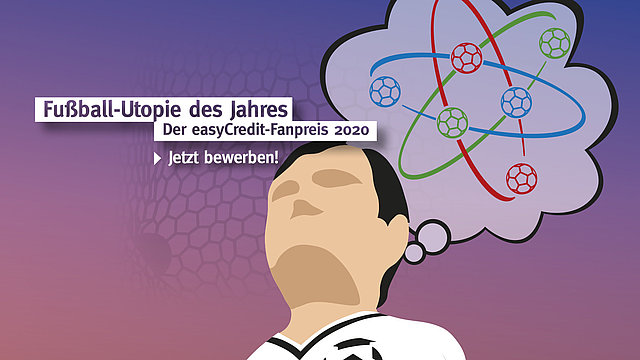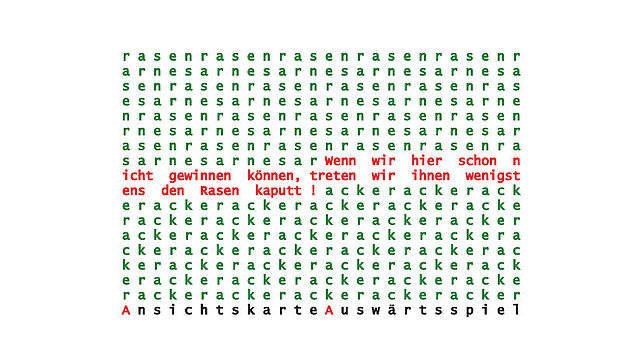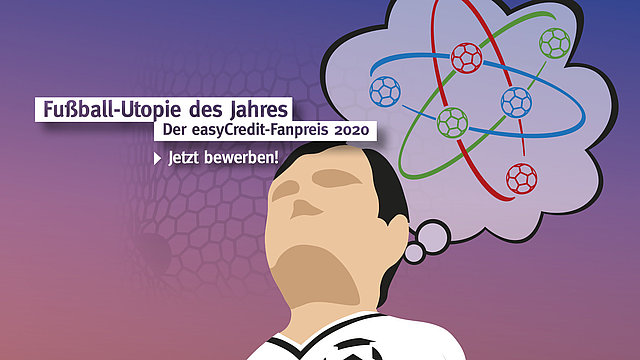Mit der Fußball-Utopie "Sportschule 2.0 – Konzept für einen nachhaltigen und regionalen Jugendsport vom Amateur- zum Profibereich" bewirbt sich Kai Wechsler um den mit bis zu 5.000 Euro dotierten easyCredit-Fanpreis 2020. Bewerbungen waren bis zum 31. August 2020 möglich. Alle Informationen zur Teilnahme am Wettbewerb "Fußball-Utopie des Jahres"
Sportschule 2.0 – Konzept für einen nachhaltigen und regionalen Jugendsport vom Amateur- zum Profibereich (von Kai Wechsler)
Beim Blick in eine der untersten U19 Amateurligen wird man mittlerweile mit Vereinsnamen konfrontiert, für die nicht mal drei Zeilen in der Tabelle ausreichend sind. Spielgemeinschaften von 3 oder mehr Vereinen sind dort eher die Regel, als die Ausnahme. Wenn ein Verein gerade mal drei Spieler in den Herrenbereich bringt, von denen dann noch zwei aufgrund eines Studiums in andere Teile Deutschlands ziehen, ist auf kurz oder lang der Spielbetrieb nicht mehr aufrecht zu halten. Das liegt zum einen natürlich am demografischen Wandel, aber auch an gestiegenen Anforderungen der Verbände, sowie veränderter Interessen und Angebote für Jugendliche. VideoStreaming, Gaming, Smartphones, Instagram, TikTok sind nur einige der digitalen Angebote, mit denen Jugendliche überhäuft werden. Zudem müssen Eltern auch mal zwischen dem neuesten Smartphone und Laptop oder der Jahresgebühr für die Vereinsmitgliedschaft und neuer Trainingsausstattung entscheiden. Es braucht Konzepte und viel Zeit, um Jugendliche wieder an den Sport zu binden und dafür benötigt es leider auch Geld. Bisher verpasst es der Profisport, einen nennenswerten Anteil der generierten Erlöse an die Basis weiterzuleiten und damit seine Struktur nachhaltig und von unten herauf aufzubauen. Stattdessen führte das aktuelle System dazu, dass, nach eigener Aussage der DFL, innerhalb weniger Wochen zahlreiche Vereine der ersten beiden Profiligen durch die Corona-Krise existenzgefährdet sind. Es wurde bereits ein Ende des Fußballs "wie wir ihn kennen" prognostiziert, weshalb auf der einen Seite viele kleinere Vereine nun für eine "gerechtere" Verteilung der Gelder plädieren, während auf der anderen Seite Rufe nach einer europäischen "Superliga" laut werden. Dort könnten sich einige wenige Spitzenteams pro Nation der Umverteilung entziehen und sich stattdessen in einer neuen Liga zusammenschließen und gemeinsam vermarkten. Dabei würden sie dem nationalen Fußball massenweise Gelder entziehen, die die anderen Vereine deutlich härter als eine Corona-Krise treffen dürfte.
Für meine Fußballutopie ergibt sich folgende problematische Ausgangssituation:
1) Nachwuchsmangel im Amateursport und daraus folgendes Vereinssterben in ländlichen Regionen
2) Bewegungsmangel der Jugendlichen durch massenhafte digitale Angebote
3) Fehlende Verteilung der generierten Gelder zur Basis des Amateursports und hier vor allem dem Nachwuchs
4) Möglicher Ausstieg der Spitzenteams aus dem nationalen System und damit große Verluste in der nationalen, aber vor allem internationalen Vermarktung
Diese Fußballutopie soll sich daher nicht wie viele aktuell diskutierten Konzepte auf den Profifußball fokussieren, sondern an der Basis und damit mit dem Nachwuchs anfangen. Meine Fußballutopie "Sportschule 2.0" soll einen Lösungsansatz aufzeigen, wie durch verstärkte Förderung des eigenen Nachwuchsbereichs ein nachhaltigeres System für den nationalen Fußball, aber auch den Sport generell aufgebaut werden kann.
Was ist die Sportschule 2.0?
Die Sportschule 2.0 ist eine Verschmelzung des schulischen Sportangebots mit der Jugendarbeit der Sportvereine. Statt den Schulsport in der Schule durchzuführen und davon losgelöst den Vereinssport zu betreiben, übernimmt die Sportschule sowohl die pädagogische, gesamtheitliche Ausbildung als auch den Wettkampfbetrieb durch die Sportvereine.
Es gibt bereits bestehende Konzepte zur Verknüpfung von Sport und Schule, die diese Fußballutopie mitgeprägt haben. Allen voran die Berliner Initiative "Profivereine machen Schule" von Proficlubs und Senatsverwaltung für Bildung, Jugend & Familie, die bereits im Jahr 2013 gestartet ist und eine Kooperation von Vereinen mit den Grundschulen ermöglicht. Zitat aus der Projektbroschüre: "Ehe die Kinder nach Hause gehen und auf elterliche Eigeninitiative zum Sport kommen, sind Bewegung, Sport und Spiel bereits in den Schulalltag integriert. Das ist ein inklusiver, niedrigschwelliger und sozial gerechter Ansatz."
Die Sportschule 2.0 greift dieses Konzept in den Grundsätzen auf und soll es auf den gesamten Jugendbereich ausweiten. Zentrales Merkmal dabei ist, dass die Sportschule 2.0 eine eigenständige Einrichtung, getrennt von Schule und Verein sein soll, aber von diesen gesteuert wird. Ähnlich wie die Sportvereine jetzt schon, soll die Sportschule die Kinder verschiedener Schulsysteme und sozialer Strukturen zusammenführen und gemäß individuellen Anforderungen und Leistungsvermögen fördern.
Wie ist die Sportschule 2.0 aufgebaut?
Die Sportschule unterteilt sich ähnlich dem Konzept der Grund- und weiterführenden Schule in zwei Bereiche.
1. Basissport
Der Basissport ist sportartenunabhängig und soll den Kindern und Jugendlichen von der Kita beginnend Begeisterung an Bewegung und Sport vermitteln. Die Förderung allgemeiner motorischer Fähigkeiten liegt dabei verstärkt im Fokus. Ergänzt wird der Basissport durch Sportarten spezifische Module. Wettkämpfe werden im Grundschulalter durch große Sportfeste abgehalten, bei denen die Kinder an einer Vielzahl verschiedener Sportarten teilnehmen können.
2. Fokussport
Der Fokussport beginnt mit dem regulären Übergang zu den weiterführenden Schulen (Mittel-, Realschule oder Gymnasium) und ermöglicht die gezielte Schulung und Förderung der sportartenspezifischen Fähigkeiten. Der Basissport rückt daher zeit-/anteilsmäßig in den Hintergrund und wird durch entsprechende Wahlmodule ergänzt. Mit dem Fokussport startet auch der sportartenspezifische Wettkampfbetrieb. Die Jugendlichen sollen daher ihrer Leistungen gemäß gefordert und gefördert werden, weshalb abhängig vom Alter verschiedene Förderstufen vorgesehen sind.
- U13 Förderstufe Kommunal | Kreis
- U15 Förderstufe Kommunal | Kreis | Bezirk
- U17 Förderstufe Kommunal | Kreis | Bezirk | Land | Bund
- U19 Förderstufe Kommunal | Kreis | Bezirk | Land | Bund
Jede Sportschule entscheidet dabei selbst, welche Förderstufen sie anbietet. So werden Schulen in ländlichen Regionen sich eher auf den kommunalen Amateur-Sport fokussieren, während es in den größeren Städten Landes- und Bundessportschulen gibt, die den Fokus auf den Leistungsbereich setzen.
Wie finanziert sich die Sportschule 2.0?
Die Sportschulen sollen als gemeinnützige Gesellschaften von Vereinen und Kommunen/Ländern/Bund betrieben und finanziert werden. Die jeweiligen Gesellschaftsanteile sind öffentlich und transparent und entsprechen auch dem zu leistenden Beitrag am jährlichen Haushalt der Schulen. Während kommunale Sportschulen mehrheitlich durch die ortsansässigen Vereine und die Kommunen betrieben werden, sind die Profivereine an den Landes- und Bundesschulen zusammen mit dem Bundesland beteiligt.
Ein zentrales Element bei der Finanzierung ist der Ausgleich der Ausbildungskosten in Form von Übergangskosten. Dafür wird für die Schüler ein Sportlebenslauf geführt. Die Übergangskosten gestalten sich folgendermaßen:
1. Bei Wechsel innerhalb der Sportschulen
a. Auf der Ebene von kommunaler oder Kreisförderstufe oder zwischen diesen Stufen -> immer kostenfrei
b. Beim Übergang auf höhere Stufe (mind. Bezirk) oder auf niedrigere Stufe-> festgelegte Ausbildungsentschädigung an abgebende Schule gemäß Schulanteilen
2. Bei Übergang in die Seniorenmannschaften der Vereine -> festgelegte Ausbildungsentschädigung basierend auf Ligenzugehörigkeit der Seniorenmannschaft und Schulstufe
3. Bei Wechsel zwischen den Seniorenmannschaften werden ebenfalls festgelegte Ausbildungsentschädigungen fällig, die proportional an alle an der Ausbildung beteiligten Schulen vergeben werden; die Ausbildungsentschädigung entspricht dabei immer mindestens 50% der Ablösesumme
4. Bei kostenpflichtigen Verpflichtungen von Spielern aus dem Ausland wird eine Pauschale von 25% der Transferkosten in einen regionalen Fond eingezahlt, der an die Schulen auf Kommunalebene ausgezahlt wird.
Bei allen Übergangskosten gilt das sogenannte "non-matching Prinzip". Das Prinzip bedeutet, dass nur die Anteile an den Übergangskosten jeweils fällig werden, die nicht selbst in die Sportschulen eingebracht werden. Hält ein Fußballverein beispielsweise 80% der Anteile an der Sportschule, von der er den Spieler in die eigene Seniorenmannschaft überführt, so zahlt er nur 20% der festgelegten Summe.
Dieses Konzept setzt auf der einen Seite einen Anreiz für die Vereine in die Schulen zu investieren und daraus folgend dann auch auf Schüler dieser regionalen Schulen zu setzen. Auf der anderen Seite ermöglicht er eine durchgehende Verteilung der Gelder vom Profibereich zur Basis. Die Förderung des Sports wird für regionale Unternehmen durch die breite Aufstellung wieder deutlich attraktiver, sodass die Finanzierung auf viele verschiedene statt einzelne große Beine gestellt werden kann.
Welche Vorteile bringt die Sportschule 2.0?
Die Sportschulen sollen auf der einen Seite die Begeisterung der Kinder und Jugendlichen am Sport wecken und hochhalten und so den Nachwuchs der regionalen Sportvereine sicherstellen. Dies geschieht durch eine Verknüpfung von pädagogischen und sportfokussierten Inhalten sowie Lehrmethoden, die die Kinder langfristig an den Sport binden sollen. Es soll auch den Ansatz der sozialen Vermischung fördern, der jetzt schon durch die Sportvereine aber auch beispielsweise durch Gesamtschulen eingebracht wird. Kinder- und Jugendliche erhalten eine Grundausbildung und werden dann je nach ihren Fähigkeiten in der Schule und unabhängig davon je nach ihren Fähigkeiten im Sport gefördert. Die Sportschulen stellen außerdem zusätzliche außerschulische Betreuung sicher, in Wettkämpfen sowie Wochenend- oder Feriencamps.
Die Sportvereine profitieren insgesamt von einer nachhaltigen Ausbildung, die Talente regional fördert und in den Spitzen- oder Amateursport überführt. Die Verbundenheit des Sportnachwuchs für Verein und Region wird dadurch deutlich verstärkt.
Die Sportschule soll aber auch die vorhandenen Kooperationen aufgreifen, Synergien schaffen und Ressourcen zentral nutzen. So werden jetzt schon Sportstätten von Schulen und Vereinen gleichermaßen genutzt, dies wird durch die Sportschulen weiter verstärkt. Das Berliner Konzept beschreibt auch die Eröffnung neuer Berufswege wie "Lehrer-Trainer", "Erzieher-Trainer", bzw. "Sportpädagogen", die bei Einführung der Sportschulen zentrale Bestandteile wären. Zusätzlich können beispielweise sportmedizinische Einrichtungen an den Schulen umgesetzt werden, die nicht nur die Versorgung von Sportverletzungen durch Ärzte und Physiotherapie übernehmen, sondern auch die Vorbeugung durch entsprechende Athletik- und Ernährungsschulung vorantreiben oder Konzentrations- und Entspannungsübungen vermitteln. Leistungen, die bisher lediglich in den Internaten der Nachwuchsleistungszentren vereinzelt umgesetzt sind. Das Gesamtsystem Sportschule ermöglicht auch das Wiedereingliedern vieler ehemaliger Profisportler in den Schulbereich.
Die Sportschule 2.0 kann ein nachhaltiger Motor für den Fußball in Deutschland auf Amateur-, aber auch auf Profiebene sein. Dabei lässt der Fußball vor allem auch die anderen von der Krise betroffenen Sportarten nicht zurück